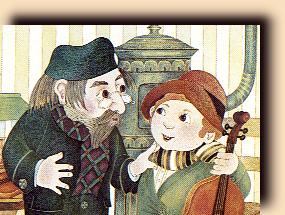
|
Jacques Offenbach war Kölner. Er kam 1819 als Sohn eines jüdischen Kantors und der Tochter eines Lotterieunternehmers in der Domstadt zur Welt.
Dies ist mehr als eine biographische Randnotiz, denn zu den Elementen, aus denen Offenbach später in Paris eine neue Gattung des Musiktheaters, die Operette, formen wird, gehörten nicht nur das Singspiel, die französische Opéra comique und das Vaudeville (eine Art Vorstadt-Varieté-Revue), sondern auch die Karnevals-Posse seiner Geburtsstadt.
Offenbach war ein begabter Cellist - so begabt, daß Luigi Cherubini als Leiter des Pariser Conservatoire 1833 eine Ausnahme machte und den vierzehnjährigen Offenbach als Studenten annahm. Ausländern war das Studium am Conservatoire eigentlich untersagt. Anschließend spielte Offenbach im Orchester der Opéra Comique. Er heiratete 1840 Herminie d'Alcain und gründete mit ihr seine eigene Familie. 1850 wurde er Leiter der Schauspielmusik an der Comédie Franηaise, wo er Couplets als musikalische Einlagen für Theaterstücke komponierte.
|
|
1855 schließlich mietete er erstmals ein kleines Theater an den Champs Élysées und eröffnete dort sein eigenes Unternehmen, das Théâtre des Bouffes Parisiens. Hier führte er eigene, immer beliebter werdende Einakter wie "Les Deux Aveugles" oder "Le Violoneux" auf. In letzterem trat zum ersten Mal Hortense Schneider in einem Werk von Offenbach auf. Sie wurde seine bevorzugte Interpretin, für die er seine großen Partien schrieb.
Als Offenbach sich mit "Orphée aux Enfers" 1858 erstmals an ein abendfüllendes Werk wagte, schlug die Geburtsstunde der Operette, wobei die Gattungsbezeichnung "Operette" keineswegs von Offenbach selbst stammt. Lediglich einige wenige Einakter bezeichnete Offenbach als "Operette" im Sinne von "Operchen". In der Regel bevorzugte er den Begriff "Opéra bouffon". Wenn man aber nun schon bereit ist, die von Offenbach erfundene Musikgattung "Operette" zu nennen, dann muß gesagt werden, daß diese Gattung eigentlich mit ihm beginnt und auch mit ihm endet.
Schon die Übertragung ins Deutsche nimmt der neuen Gattung ihren scharfen Witz, wendet konkrete Gesellschafts-Satire ins Allgemeine. Das gilt selbst für ein so gelungenes Werk wie die 1874 uraufgeführte "Fledermaus" von Johann Strauß, dessen Libretto auf einem Theaterstück von Offenbachs Librettisten Meilhac und Halévy basiert. Und bald darauf versinkt die "Wiener Operette" im Walzerkitsch und die "Berliner Operette" in zackigem Marsch-Rhythmus. Lediglich einzelne Werke, wie "Die lustigen Nibelungen" von Oscar Straus (1904), atmen noch einmal Witz und Geist der "Offenbachiaden".

|
Mit dem Begriff "Offenbachiade" beschreibt der Offenbach-Biograph Siegfried Kracauer das neue Genre. So anschaulich diese Wortschöpfung auch ist, so sehr verkürzt sie Offenbachs Oeuvre auf seinen populäreren Teil und trägt bei zu dem Mißverständnis, das da besagt, Offenbach habe sein Leben lang Operetten geschrieben und ganz am Ende seines Lebens eine große Oper, "Les Contes d'Hoffmann".
Tatsächlich hat Offenbach neben seinen Operetten immer wieder Opern geschrieben: von der großen romantischen Oper "Die Rheinnixen" (1864) über komische Opern wie "Robinson Crusoe" (1867), "Vert-Vert" (1869) oder "Fantasio" (1872) bis zu seinem posthum aufgeführten Spätwerk, den "Contes d'Hoffmann" (1881). Für den eher mäßigen Erfolg, den die meisten dieser Werke errangen, lassen sich verschiedene Gründe ausmachen, wie z.B. Intrigen an der Opéra Comique. Die dort etablierten Komponisten waren sich offenbar sehr wohl bewusst, welche Konkurrenz ihnen da von dem Mann drohte, den Rossini den "kleinen Mozart der Champs Élysées" nannte.
|
|
So waren es vor allem die Werke, die Offenbach in seinem eigenen Theater Bouffes Parisiens uraufführte, die seinen Ruhm begründeten. In zahlreichen Einaktern konzipierte Offenbach gemeinsam mit seinen Librettisten Werke, die den Geist der Zeit zugleich trafen und parodierten. Nach dem Durchbruch mit dem abendfüllenden "Orphée" entwickelte Offenbach in den Folgejahren seine neue Gattung musikalisch und inhaltlich mit Werken wie "La Belle Hélène" (1864), "Barbe-Bleue" (1866), "La Vie Parisienne" (1866) und "La Grande Duchesse de Gerolstein" (1867) stetig weiter, bis er mit "Les Brigands" (1869) einen Endpunkt erreichte.
Dieser war nicht nur künstlerisch sondern auch politisch diktiert: der deutsch-französische Krieg 1870/71 und der Zusammenbruch des Ancien Régime läuteten das Ende einer Ära ein und beraubten Offenbach seines Publikums. Er galt nun als "veraltet", sogar als "Verderber der Sitten". Zudem wandten seine wichtigsten Librettisten Meilhac und Halévy sich immer mehr dem Sprechtheater zu und seine Lieblingsinterpretin Hortense Schneider zog sich von der Bühne zurück. 1874 war Offenbach bankrott und mußte sein Theater verkaufen.
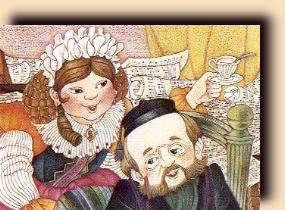
|
"Les Brigands" sollten die letzte der großen "Offenbachiaden" sein. Spätere Werke wie "La Fille du Tambour-Major" (1879) fielen zwar nicht vom musikalischen Niveau ab, ließen aber die geistige Schärfe von einst vermissen.
Offenbach suchte einen neuen Weg und fand ihn, indem er sich - nach einigen Versuchen in der damals modernen Gattung "Opéra féerie" (Märchen-Opern mit aufwendiger Ausstattung) wie "Le Roi Carotte" (1872) und "Le Voyage dans la lune" (1875) sowie weiteren komischen Opern wie "La Créole" (1875) und "Madame Favart" (1878) - abermals der großen Oper zuwandte und mit "Les Contes d'Hoffmann" ein Alterswerk schuf, welches seinen Ruf als einer der bedeutendsten Komponisten des 19. Jahrhunderts dauerhaft festigte.
Die Premiere 1881 konnte Offenbach nicht mehr erleben. Er starb 1880 in Paris.
Die Zeichnungen stammen aus dem Buch zum Hörspiel "Offenbach - raconté aux enfants".

